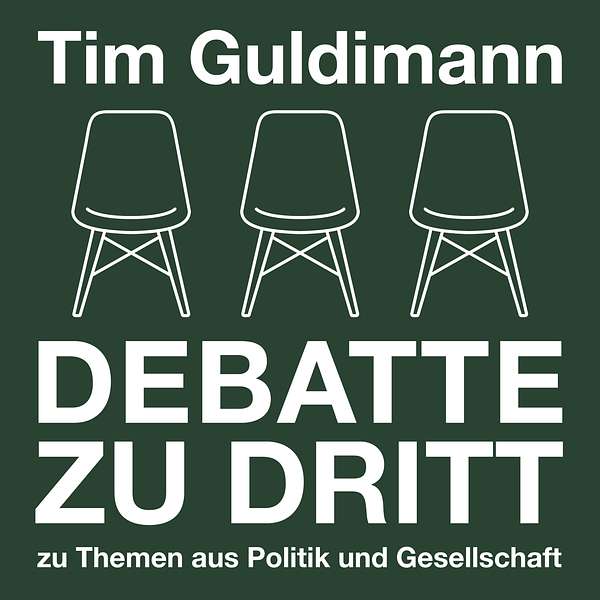
Tim Guldimann - Debatte zu Dritt
Tim Guldimann - Debatte zu Dritt
„Die Bilder von Bührle & Gurlitt – Wie sollen Museen mit Raub und Fluchtkunst umgehen, die von Shoa-Verbrechen belastet sind? – mit Ann Demeester und Guido Magnaguagno
Raubkunst ist kein Thema der Vergangenheit, sondern bleibt eine offene Wunde. Wie sollen Museen mit Bildern umgehen, die durch nationalsozialistische Verbrechen belastet sind? Darüber spreche ich mit der Direktorin des Kunsthauses Zürich Ann Demeester und mit Guido Magnaguagno, Kunsthistoriker und Kurator. Es geht um Raubkunst, Fluchtgut und die Frage der historischen Verantwortung.
Emil Bührle hat als Waffenfabrikant während des Zweiten Weltkriegs ein Vermögen gemacht und damit seine Kunstsammlung finanziert, die heute in Zürich ausgestellt wird. - Cornelius Gurlitt war der Sohn eines Kunsthändlers im Dritten Reich, der nach 2012 weltbekannt wurde durch den spektakulären Fund seiner großen Sammlung von zum Teil Raub- und Fluchtkunst. Er hat diese Sammlung dem Kunstmuseum Bern vermachte.
„Juristisch ist vieles verjährt, heute geht es nur noch um Moral und Ethik“, sagt Magnaguagno und zitiert den Schriftsteller Lukas Bärfuss: „Die Schweiz war und ist immer sehr gut in Erledigungskultur, aber nicht in Erinnerungskultur“. Demeester macht klar: “Geschichte ist nie zu Ende, wir können nicht einfach sagen: jetzt ist Schluss.“
Es geht um das Verhältnis zwischen Recht und Moral, um die Rolle der Schweizer Eliten im Zweiten Weltkrieg und um die Frage, ob Kunst jemals frei von ihrer Geschichte gezeigt werden kann.
Ein technisches Problem 😢 : Der Ton von Ann Demeester ist schlecht, sorry, das Thema aber zu wichtig, um zu schweigen. Deshalb habe ich den schriftlichen Text der Debatte hier zugänglich gemacht.
🎧 Hör jetzt rein und bilde dir deine eigene Meinung
Willkommen zur „Debatte zu dritt. Ich bin Tim Guldimann. „zuzweit wäre es ein Interview, „Zu dritt ist eine Debatte. Hier diskutiere ich jeweils mit einer Frau und einem Mann über politische und gesellschaftliche Themen. Wie sollen Museen in der Folge der Naziverbrechen bezüglich Raub-und Fluchtkunst umgehen? Das ist die Frage der heutigen Debatte. Ich freue mich, dazu zwei Persönlichkeiten begrüßen zu dürfen, die in diesem Zusammenhang aktiv und kompetent sind. Das ist zum einen Anne Demeester, Sie sind seit drei Jahren Direktorin der Kunsthauses Zürich. Zuvor waren Sie während 20 Jahren in Holland im Museumsbereich tätig. Sie leiteten das de Appel Kunstzentrum in Amsterdam und danach das Frans Hals Museum in Haarlem. Sie sind aber Belgierin geblieben, auch hier in Zürich. - Herr Magnaguagno, ja stellen Sie sich doch selbst schnell vor.
Guido Magnaguagno:Okay, und ich war tatsächlich Vizedirektor auch in diesem Haus, vorher Kurator und zwar etwa von 1980 bis 2000. Habe sehr viele Ausstellungen gemacht in diesem Haus oder machen dürfen. Und in unserem Zusammenhang von unserem Thema ist, glaube ich, wichtig, dass ich 2015 mit Mitherausgeber des Schwarzbuchs Bührle war. Mitunter hat mit diesem Buch die Diskussion, die ellenlange bis heute andauernd begonnen. Später war ich Experte bei der ganzen Gurlitt-Geschichte für die Deutsche Zentralstelle Kulturgutverluste.
Tim Gulidmann:Kulturgutverluste im Kontext des Nationalsozialismus, das ist das Thema und dazu die zwei Namen Gurlitt und Bührle. Zuerst zur Person Emil Bührle, dessen Bildersammlung hier Im Kunsthaus ausgestellt wird. Ein Deutscher, der in den 20-er Jahren als Waffenproduzent in die Schweiz kam, und von hier aus mit grossem Erfolg seine Kanonen vor allem nach Deutschland für Hitlers Angriffskriege lieferte. So wurde er bald zum reichsten Schweizer, der seine Gewinne über lange Jahre in Bilder, vor allem französische Impressionisten investierte. Bührle prägt damit zusammen mit Gurlitt die Kunstraubdebatte der letzten Jahre. Es geht um die Frage von Herkunft, Eigentum und Rückgabe von Kunstwerken, die im Kontext der Shoa von den Nazis geraubt wurden oder von Juden und Jüdinnen auf ihrer Flucht Zwangsverkauft werden mussten. Die Frage bleibt aktuell. Im Februar dieses Jahres wurde bekannt, dass sich in den bayrischen Staatsgemäldesammlungen 200 NS-Raubkunstwerke befinden. Der Skandal führte zum Rücktritt des Generaldirektors der Staatsgemäldesammlung. Vor einigen Tagen wurde in Argentinien ein vom SS-Offizier Friedrich Kadgien vor 80 Jahren geraubtes Bild sichergestellt. - Die Tochter stellte für den Verkauf ihrer Wohnung ein Foto ins Internet mit ihrem Sofa und dem Bild darüber. Damit wurde das bekannt und dann kam die Polizei. Kadgien war als Handlanger von Göring für die Verwertung von jüdischem Vermögen tätig. Wir sehen, die Debatte kommt nicht zur Ruhe. Zuerst zur Sammlung der Stiftung Bührle im Erweiterungsbau des Kunsthauses Zürich. In diesem eindrucksvollen Gebäude des Star-Architekten Chipperfield nehmen wir heute unsere Debatte auf. Ich habe vorher beim Besuch der Ausstellung feststellen können, da gab es enorme Veränderungen. Vor vier Jahren habe ich die Ausstellung zum ersten Mal kurz nach ihrer Eröffnung gesehen. Damals wurde die Doppelrolle von Bührle als Waffenproduzent und als Kunstmäzen etwas verstohlen, in einer Ecke im zweiten Stock abgehandelt Heute ist diese höchstproblematische Geschichte in die Ausstellung voll integriert worden. Woher kommen diese Kunstwerke? Woher kam das Geld dafür? Es geht also den Zusammenhang von Bührle's Waffenproduktion. Auch den Kunstraub, der einige der Bilder erst auf den Markt gebracht hat. Wie haben Sie, Frau de Meester, die letzten Jahre hier in Zürich erlebt? Sie sind ja erst 2022, das heißt, nach der Eröffnung des Neubaus, als neue Direktorin zum Kunsthaus gekommen. Sie haben einmal gesagt, die Bührle Erfahrung sei für Sie ein ewiger Lernprozess. Wie erleben Sie als Belgerin und mit Ihrer langjährigen Tätigkeit in Holland und damit aus der historischen Betroffenheit dieser beiden Länder unter der Naziherrschaft den Umgang von Zürich und den Umgang der Schweiz überhaupt mit der historischen Dimension der Bührle-Sammlung.
Ann Demeester:Ich bin natürlich in medias res reingekommen. Es gab, bevor ich kam, so viele Episoden in dieser Diskussion, die ich nun rein theoretisch kenne auf Papier. Und als Direktorin war ich in den ersten Tage voll im Mittelpunkt des Skandals. Die Sammlung war neu in diesem Gebäude und das hat eine neue Debatte aufgelöst. Wieso? Das ist schwierig zu beantworten. Ich bin keine Soziologin und ich bin auch neu in die Schweiz, aber ich denke, es hat natürlich damit zu tun, dass sich der Zeitgeist geändert hat mit den Diskussionen über Raubkunst in ganz Europa. Das ist ein Thema für alle Museen. Belgien war natürlich neutral im Zweiten Weltkrieg und ist besetzt geworden. Die Niederländer haben eine sehr ambivalente Geschichte im Zweiten Weltkrieg und auch das hat sich die letzten Jahre geändert. Als ich umgezogen bin nach Amsterdam, war eigentlich der nationale Mythos der Wir waren im Widerstand. Wir haben Anne Frank gerettet und wir waren ein Land, wo wir die Juden geschützt haben. Nur die letzten Jahre, eigentlich vor allem seit anderthalb Jahren, seit der Eröffnung des Holocaust Museum, mussten die Niederländer erkennen: Nein, das sind wir nicht. Wir waren nicht kollektiv im Widerstand. Ganz im Gegenteil. Wir haben es ermöglicht als Land, dass extrem viele Juden ermordet wurden. Wir haben dort proaktiv mitgearbeitet, massiv mitgearbeitet. Ich habe auch diese Veränderung in den Niederlanden miterlebt. Von eigentlich so einem Denial (Verneinung), mit dem nationalen Mythos und dem Anne Frank Museum, sehr unterbewusst, das war nicht bewusst. Und dann plötzlich die Realität der Fakten, die man nicht mehr ignorieren könnte. Nein, das war damals eigentlich anders. Und ich glaube, wie ich es hier in der Schweiz erfahren habe, ist es ein bisschen ähnlich. In jedem Land gibt es Mythen um Krisen oder Traumas herum. Ich glaube, hier in der Schweiz, vor der Berger-Kommission, war die Gedanke: „Wir waren ein Land, wir haben uns vor Hitler geschützt, wir hatten die Armee, wir hatten die Neutralität. Und jetzt stellt es sich heraus, dass die tatsächliche Realität viel komplexer und ambivalenter ist. Und das tut weh und es ist schwierig, dem in die Augen zu sehen. In dem Sinne ist es fast vergleichbar. In Belgien ist die Diskussion ganz anders. Dort haben wir es mehr mit Kolonialgeschichte zu tun, wo von man com Denial (Verneinung) zur Akzeptanz kommt. Aber auch die Niederländer müssen in den vollen Wandel erfahren: „Wir haben eine Idee über unser Land im Zweiten Weltkrieg, aber die Fakten sagen eigentlich was anderes. Und wie gehen wir diese Diskrepanz um? Wollen wir noch damit umgehen? Herr Magnuaguagno, wie hat sich diese Debatte entwickelt in der Schweiz in den letzten Jahren? Ja, der Wind hat sich gedreht. Also vor allem mit der Eröffnungsdebatte, als die Sammlung ins Kunsthaus kam, mit der Eröffnung. Das war vielleicht der Höhepunkt, wobei diese Debatte leider nie auf Augenhöhe stattgefunden hat mit den Beteiligten, also weder mit dem Kunsthaus noch mit der Stadt und mit der Bührle Stiftung schon gar nicht. Das war ja die totale Blockade. Die saßen immer noch im Bunker und es war eine Debatte in der internationalen Presse. Ich würde sagen, ohne die deutsche Presse, wo alle wichtigen Blätter über Zürich hergefallen sind, wäre dieser Prozess nicht so schnell gelaufen, also hätte sich der Wind nicht so schnell gedreht. Aber in diesem Prozess fällt mir ein Aspekt auf, der meines Erachtens in der ganzen Diskussion immer zu kurz kommt. Nebst den beiden Rollen von Bührle als Waffenproduzent und als Mäzen geht es fast
nicht die Frage:Was war dabei die Rolle der Zürcher, der Schweizerischen Gesellschaft, die Rolle der Eliten, die diesen Waffen-Schieber mit offenen Armen und allen Ehren aufgenommen haben, ihm die Staatsbürgerschaft gegeben haben und ihm einfach nur dankbar dafür waren, dass er Kunst in die Stadt gebracht hat. Und mit dem Erweiterungsbau hoffte Zürich, das Museum zum Leuchtturm in der europäischen Museumlandschaft zu machen, hoffte quasi auf einen Bilbao-Effekt, so wie sich Bilbao mit dem Guggenheim Museum aufwerten konnte. Und dann musste man plötzlich feststellen, das fliegt uns wegen der Raubkunstproblematik jäh die Ohren. Aber die Frage der Rolle unserer Gesellschaft, die Rolle unserer Eliten in dieser ganzen Geschichte, wird kaum gestellt. Nun jetzt zum zweiten Namen, Gurlitt. Hier habe ich eine persönliche Erfahrung. Im Jahre 2014 hat Cornelius Gurlitt bei seinem Tod 1600 Werke, die er von seinem Vater geerbt hatte, dem Kunstmuseum Bern vermacht, das als private Stiftung betrieben wird. Cornelius Gurlitt war der Sohn des Kunsthändlers Hildebrandt-Gurlitt, Kunsthändler im Dienste von Adolf Hitler. Ich war damals Schweizer Botschafter in Berlin und da rief mich eines Tages die Kulturstaatsministerin Monika Grütters zu sich und sagte mir, es sei ihr und ihrer Regierung und der Regierung des Freistaates Bayern ein großes Anliegen, dass das Kunstmuseum Bern diese Erbschaft annehme, denn wenn dieses Museum das nicht tue, würden die Erben der Familie die Erbschaft wohl auf dem internationalen Kunstmarkt verscherbeln. Und das hätte wegen der damit verbundenen Raubkunstfrage böse politische Folgen für Deutschland. Ich habe das dann sehr stark unterstützt, notabene auch gegen Widerstände in Bern, weil mir sehr rasch klar wurde, dass die deutsche Seite bereit wäre, anfallende Kosten zu übernehmen. Es ging nämlich die Kosten für eine minutiöse Erforschung der Provenienz dieser Kunstwerke. Während Monaten wurde ein Vertrag ausgehandelt, in dem sich Berlin und Bayern bereiterklärten, die gesamten Kosten dieser Abklärungen zu übernehmen. Damit kam das Kunstmuseum Bern in den Besitz all jener Werke aus dem Konvolut von Gurlitt, bei denen wasserdicht abgeklärt werden konnte, dass es sich nicht Raub-oder Fluchtgut handelte. Das war ein Glücksfall für Bern. Was ist Ihre Erfahrung aus diesem Fall? Inwiefern hat diese Gurlitt-Geschichte die ganze Provenienz-Debatte angetrieben? Mein Eindruck ist, dass sich heute wegen dieser Debatte viele Museen fragen müssen, ob sie Leichen im Keller haben. Das könnte für die Museen ja sehr teuer werden, wenn sie die Provenienz selbst erforschen müssen. Ich denke, dass Gurlitt für den deutschsprachen Raum sehr viel Effekt gehabt hat, im positiven Sinne. Ich glaube, auch Bührle war Katalysator, vielleicht eher negativ. Aber generell ist es wirklich so die letzten zehn Jahre in europäischen Museum. Provenienzforschung hat es immer gegeben. Jetzt wissen alle, dass das Risiko besteht, dass in Sammlungen Werke von Kolonial-, Raubgut sind. Und die Investition in Provenienzforschung wird überall in Europa verstärkt. Ich glaube, hier in der Schweiz ist Bührle ein Katalysator, um das zu beschleunigen und zu sagen, wie notwendig es auch hier ist. Es ist kein Luxus, es gehört jetzt zum Standart, was ein Museum macht, dass man die Provenienzforschung verschärft und dass man eigentlich damit rechnen muss, dass es überall noch Fälle gibt. Ja, nicht viel beizufügen, außer dass das eben die Diskussion beflügelt hat. Und diese Berner Erfahrungen und die Position, die die Berner eingenommen haben, wurde auch für Zürich ganz wichtig.
Zürich wurde dann immer vorgeworfen:„Ihr seid total im Hintertreffen und schaut mal nach Bern, wie die das gemacht haben. Die haben eine ganz tolle Ausstellung gemacht oder sogar zwei, nicht in Bern. Also Zürich muss sich auf die Beine machen. Wie erleben Sie, Herr Magnaguagno, die politische Debatte in Bern, da voranzukommen? Wo jetzt? In der Provenienz?. Also wir sind einen großen Schritt weiter bei der Wahrheit. Und das ist vor allem der Bericht von Raphael Groß. Das ist ein entscheidender Schritt Richtung Wahrheit. Ich meine, es geht jetzt um 133 von 203 Werken, die unter Verdacht stehen. Das mit dem Bericht von Raphael Groß muss ich kurz erklären. Raphael Groß ist Präsident des Deutschen Historischen Museums und er hat den Auftrag gehabt, die Frage neu anzugehen, wie die Bührle-Stiftung mit der Provenienzfrage in ihrer Sammlung umgegangen ist. Ihre Ausstellung, Frau Demeester, hat seinen Bericht prominent aufgenommen.
Seine Schlussfolgerung war:Die Stiftung selbst habe sich zum Richter über ihr eigenes Verhalten gemacht und sei, was ja nicht überraschen kann, zum Resultat gekommen. Alles nicht so schlimm, alles kein Problem. Und das hat Groß kritisiert. Ja, das war von Anfang an eine Mogelpackung. Also was die Stiftung auch für teures Geld 20 Jahre gemacht hat, war einfach unter Ausschluss des Wortes „Jüdisch". Das Wort kam gar nicht vor, 20 Jahre lang. Klar, das ist die Brisanz beim ganzen Thema gewesen. Und jetzt liegt es auf dem Tisch. Ja, aber Sie haben auch die Frage gestellt auf die nationale Ebene, weil dort, denke ich, die ganze Debatte um Bührle und Gurlitt herum eigentlich dafür gesorgt hat, dass jetzt auch die Schweiz auf Bundes-Niveau denkt: „Wir müssen Schritte unternehmen. Es gab es Emotion, die zu einer unabhängigen Expertenkommission führen muss. Ich bin selber sehr gespannt, weil das ist, glaube ich, extrem wichtig, die Diskussion über Provenienz zu normalisieren. Ich warte wirklich mit Schmerz oder mit Ungeduld auf diese Kommission, weil das würde bedeuten, dass man auf Einzelfälle eingeht, und dass so eine Norm etabliert wird für die Schweiz. Sie hoffen also auf Normen für die Schweiz und Warten mit Ungeduld und Schmerz, wie Sie sagen, darauf. Es gibt aber auch internationale Normen für den Umgang mit Raubkunst, an die man sich halten sollte. Da gibt es die Washingtoner Prinzipien 1998. Danach erweiterte die Folgeerklärung von Vilnius den Gegenstand von Kunst generell auf Kulturgut. Danach folgte eine Erklärung in Theresienstadt und berücksichtigte zusätzlich den Verkauf in einer Zwangslage und schließlich erklärten Best Practices vom März 2024 auch Fluchtgut als anspruchsberechtigt. Das ist alles gut und recht. 23 Staaten, darunter auch die Schweiz, haben diese Prinzipien anerkannt und sogar im Falle von zu erwartenden Informationslücken – und das ist wahrscheinlich der Regelfall – sollen "gerechte und faire Lösungen", wie es heißt, gefunden werden. Na ja, das Problem ist, das ist alles Soft-Law. Das heißt, die konkrete Wirkung für die Rechte der Opfer und ihrer Nachkommen ist beschränkt, denn damit wird keine gesetzliche Grundlage für zivilrechtliche Klagen vor Gericht geschaffen. Und natürlich gibt es eine moralische Verpflichtung, vor allem für öffentliche Institutionen, wie für staatliche Museen. Aber wie können die Geschädigten zivilrechtlich vorgehen? Das ist eigentlich das Problem. Kann man nicht. Ist ja verjährt im juristischen Sinn. Es geht nur Moral und Ethik heute. Und was Sie erwähnt haben, sind alles wichtige Schritte gewesen, also vor allem die Erklärung von Terresyn (Theresienstadt). Da wurde eigentlich der heute wichtige Begriff eingeführt des NS-verfolgungsbedingten Entzugs oder wie wir lieber sagen, des Verlusts, also aus der Opferperspektive, nicht aus der Täterperspektive. Aber das ist heute akzeptiert und was alles darunter fällt. Das führt zu dem Thema, was Anne angesprochen hat, zu dieser Kommission. Also da wird ja auch Geld ausgegeben für die Museen insgesamt, die Schweizer Museen, also ihre Sammlungen, die untersucht werden müssen. Das ist okay, das ist gut. Andererseits hat die Regierung mit dieser Kommission unglaublich geschlampt. Da hat doch der Präsident der Bührle Stiftung Alexander Jolles einmal die Frage
gestellt, Zitat:„Ob nicht der Zeitpunkt gekommen ist, die Dinge ruhen zu lassen im Interesse des Rechtsfriedens und aus der Erkenntnis, dass Geschichte nicht rückgängig gemacht werden kann." Na ja, nicht die Geschichte, aber die Gerechtigkeit kann ja zurückgeholt werden und das ist nicht das Gleiche. Ja, ja, ja. Auch die Wahrheit und die Gerechtigkeit ist nicht dasselbe. Ja, klar, mit anderen Worten, die Geschichte ist nie zu Ende oder Geschichte ist nicht Vergangenheit. Wir können nicht an einem bestimmten Punkt sagen: „Jetzt ist Schluss, jetzt ist es abgearbeitet, jetzt ist es vorbei". Ich denke, diese Entscheidung kann niemandem treffen und vor allem nicht, was
wir immer wieder spüren:Es gibt auch neue Generationen, die einfach andere Ideen haben darüber, wie man mit Vergangenheit umgeht. Und es ist eigentlich diese Generation, die uns verpflichtet, auch in Zukunft verpflichtet. Es gibt mehr als nur diese Diskussion. Es gibt auch andere Issues, wo wir debattieren müssen. Wir können sie jetzt nicht artefiziell abschließen. Ich hoffe nur selber, dass die Diskussion ein bisschen ausgeglichener wird. In dem Sinne, was wir in der Bührle-Debatte spüren: in der Ausstellung, haben wir eine digitale Besucher-Umfrage gemacht. Und dort sagt eigentlich ungefähr 80% der Besucherinnen und Besucher: „Ja, wir wollen diese Sammlung sehen und wir wollen sie mit Kontext sehen". Das ist so die Oberfläche. Aber dann, wenn wir Menschen persönlich ansprechen in der Stadt, gibt es eigentlich nur zwei extreme Positionen.
Die eine Position sagt:„Ja, jetzt ist Schluss. Man hat schon genug diskutiert und das sollte jetzt mal vorbei sein." Und das
andere Extrem, wo sie sagen:„Nein, immer weiter, immer pushen, noch mehr ins
Detail, noch mehr Fokus." Und ich denke:Ja, wenn wir diese Diskussion wirklich führen wollen, müssen wir Bührle in den Kontext ziehen und sagen: „Ja, die Diskussion über Bührle führen wir, aber wir müssen diese Diskussion auf außerhalb des Kunsthauses führen über die Frage, wieso, was war da der größere Kontext? Und wir haben ja gar nicht gesagt, die Bergier-Kommission habe alles erforscht, aber ist es auch verdaut? Die Information ist da, aber was tun wir damit? Und das ist, glaube ich, das hat noch nicht stattgefunden. Und solange das nicht stattgefunden hat, wird die Diskussion immer wieder passieren. Ja, dass dieses mentale Réduit (Begriff für das im 2. Weltkrieg geplante Rückzugsgebiet der Armee in den Alpen), von dem Jakob Danner noch immer spricht, dem sich viele Schweizer noch befinden, die sich weigern, diese Insel, den Sonderfall Schweiz aufzugeben und die Schweiz in diesem grösseren Kontext zu sehen, dass sie eben auch ein Täterland war, so wie Holland ein Täterland war, mit diesen tausenden von Denuntiationen, wie das erst kürzlich zum Vorschein gekommen ist. Bei der Schweiz, würde ich sagen, war das die Flüchtlingspolitik, auch im Bergier-Bericht fast die Hauptsache, die die Schweiz zu Täter machte. Alle die abgewiesen Juden an den Grenzen, die sofort nach Auschwitz deportiert wurden. Also in dem Sinn gehört Auschwitz eben auch zur Schweiz. Also es geht hier nicht, wie Jolles meint, um Rechtsfälle, einzelne Rechtsfälle. Es geht eigentlich um eine Schuld, die die Länder haben. Und die Schweiz hatte, glaube ich, jahrzehntelange ein keinerlei Unrechtsbewusstsein, sie habe nichts damit zu tun, mit dem Nationalsozialismus. Na ja, so eindeutig mit dem Selbstbild, das wir uns von der Schweiz machen, ist es ja heute nicht mehr. Natürlich gibt es vor allem in älteren Generationen immer noch die Illusion des Sonderfalls. Ich sehe das Problem eher darin, dass man zwar erkennt, das stimmt nicht mehr so ganz, aber wenn man sich fragt: „Was stimmt denn heute? Wer sind wir?" Dann weiß man es eigentlich nicht mehr so genau. Und natürlich ist die Identität des eigenen Landes historisch gewachsen, aber das Alte geht nicht mehr und man weiß nicht so genau, was das Neue ist, und das verunsichert. Es geht auch nicht um den Beweis, dass der Wilhelm Tell nie gelebt hat.
Peter von Mart hat mal gesagt:„Wilhelm Tell ist heute nur noch peinlich." Aber
darum geht es nicht, sondern um die Frage:„Wer sind wir im Lichte unserer Vergangenheit?" Und das gilt auch für unser Thema heute. Ja, das haben Sie sehr poetisch und prägnant zusammengefasst. Sie haben ja am Anfang gefragt, wie haben Sie als Belgierin die ganze Diskussion gesehen? Und ich denke, man sieht einfach immer Vieles klarer, wenn es um die Vergangenheit von anderen geht. Und dabei meine ich mich als Belgierin in der Schweiz, aber wenn ich meine Ursprungsländer anschaue, Belgien und die Niederlande. Belgien hat lange seine Kolonialvergangenheit, die extrem gewalttätig ist, verschwiegen oder ein bisschen versucht sie runterzuspielen. Es brauchte Amerikaner, um das hervorzunehmen. Und dann gab es in Holland, vier Jahre später extrem viel Interesse an die Kolonialgeschichte Belgiens und fand über die Kolonialgeschichte der belgischen das Urteil. Und das war einfach. Als dann die Diskussion kam, als der selber Autor ein Buch über die Kolonialgeschichte in Indonesien geschrieben hat , war das Buch viel weniger geliebt. Es ist einfacher, die Vergangenheit von einem Land zu sehen, zu dem man nicht gehört, weil man dann die Identitätsfrage nicht stellen muss. Wie sehen Sie die Schweiz? Gott, das ist eine sehr schwierige Frage. Ich meine, im Moment ist die Schweiz wirklich wieder ein Refugium in Europa, denke ich, nicht in dem Sinne (wie vorher erwähnt), ich habe Mühe, es prägnant und intelligent zu formulieren. Wenn ich die Niederlande anschaue, die Demokratie ist völlig explodiert. Es gab eine rechtsextreme Regierung, die hat nicht Stand gehalten, die ist gefallen. Und überall in Europa sieht man, dass eine normale politische Diskussion mit Austausch von Meinungen und Argumenten einfach nicht mehr stattfindet und dass die Parteienideologie eigentlich das ganze politische Geschehen dominiert. Und in dem Sinn, finde ich, im Moment ist die Schweiz eine Refugium, weil man hier auf jeden Fall versucht, auf föderaler Ebene noch Politik zu betreiben, mit Argumente, mit Fakten, mit Austausch und nicht nur getrieben ist von der Parteienideologie. Also im Moment sehe ich die Schweiz als sehr ausgeglichenes Land. Auch im Kunstbetrieb, wo Sie tätig sind? Ja, im Kunstbetrieb ist es vielleicht schwieriger zu sagen, weil ich glaube, dort in den Niederlanden haben Museen sich in den letzten 15 Jahren extrem gewandelt
und dann habe ich gesagt:„Ja, Kunstmuseen sind für die Kunst da, aber da kann man die gesellschaftliche Debatte nicht ignorieren, weil es gibt keine Berliner Mauer zwischen Kunst und Gesellschaft. Und in Holland ist das selbstverständlich geworden, dass das Museum sich zu der Außenwelt verhält. Das bedeutet nicht, dass alles so politisch und kritisch und aktivistisch ist. Das bedeutet, man kann Kunst nicht sehen als eine Insel oder ein Berg oder ein Palast, wo alles verschüttet ist und realitätsfremd. Und ich glaube, in der Schweiz sind Museum noch in diese Wandlung von: „Ja, wie gehen wir damit um? Wir sind nicht mehr eine Insel. Es bedeutet auch nicht, dass alles politisch wird, aber wie bringen wir das Museum in Austausch mit der Gesellschaft? Und dort, glaube ich, gibt es noch viel Arbeit. Aber man kann dadurch auch lernen, zum Beispiel aus den Niederlanden, wenn man die Diskussion so führte, dass alles politisch würde. Alles war historisch, alles war nur Debatte. Und das ist auch nicht gut für die Kunst. Und ich glaube, die Schweiz hat jetzt die Möglichkeit, sich einen neuen Weg zu finden, wo die Kunst noch die Kunst sein kann, aber wo das Museum auch sagt: „Ja, wir sind es auch in Bezug auf die Gesellschaft. Sie probieren das ja mit Ihren neuen Ausstellungen, diesen drei neuen Ausstellungen, diesen Weg zu gehen, dass die Kunst auch Kunst sein darf. Finde ich als Kunsthistoriker natürlich auch ganz wichtig, weil ich diese Bilder liebe, die Künstler liebe. Ich liebe nicht, dass immer noch Bührle drauf steht. Und das wird man sehen, wie da die Diskussion weitergeht, weil das war ja die dritte Forderung von Raphael Groß, die völlig unterging in den jetzigen Diskussionen, dass dieser Name verschwinden muss. Man muss die Bilder befreien von diesem Stigma oder diesem Signum „Bührle" und so. Man muss auch die Künstler befreien wieder von diesem Namen. Und das ist noch ein ganz weiter Prozess. Ich meine, was Sie jetzt gesagt haben, Ann, das wäre schön, wenn diese Blockaden aufgegeben würden. Und ich weiß, Sie sind in einer schwierigen Position vis-a-vis von der Bührle-Stiftung vor allem. Die Stadt hat sich auf den Weg gemacht und so. Also das sieht alles sehr viel besser aus. Jetzt sind die am Kunsthaus so Tafeln verteilt von Verdachtsfällen und am Schluss sind dann einfach alles Verdachtsfälle, wie bei Gurlitt und so. Diese In-Haus-Forschung finde ich gefährlich.
Kurze Schlussfrage:Einerseits ist die Aufgabe, die Kunst wieder als Kunst gelten zu lassen und damit die Kunstwerke der Bührle-Sammlung vom Namen Bührle zu befreien Und im Gegensatz dazu die historische Frage, der Sie, Frau Demeester, in diesem Museum nachgegangen sind, nämlich diese Sammlung in den direkten Zusammenhang mit dem Wirken des Waffenproduzenten Bührle zu stellen. Was macht man jetzt? Heißt das für die Zukunft in irgendeinem Moment? Man hat das jetzt abgearbeitet, es ist erledigt und ist in der Lage, diese Kunst vom Stigma Bührle zu befreien? Oder geht das gar nicht? Frau Demeester, was machen Sie mit der Sammlung in fünf Jahren. Ein evolutionäres Modell, weil diese Aufstellung hat nicht alles erledigt. Sie waren ein wichtiger Schritt, zu zeigen, Kunst, Geschichte und Geschichte gehören zusammen. Wir müssen das mal adressieren, dass es wirklich im Raum steht. Und wir müssen die Probleme benennen oder die Dilemmas. Und ich denke, der nächste Schritt ist nicht, dass die Kunst einfach wieder Kunst ist. Das ist unmöglich. Ich denke, unser nächster Schritt ist, zu sagen, eigentlich sollen wir uns nicht nur fokussieren basieren auf die Figur Bührle, aber auf die Tatsache, dass bevor Bührle gab es andere Sammler, die diese Werke gesammelt haben, und ein Teil davon war jüdisch und ein Teil davon haben wirklich Pioniersarbeit geleistet. Sie haben diese Werke gekauft, wenn sie noch nicht so etabliert waren, wenn es noch kein Kanun war, wenn es noch nicht glutschig war? Was war eigentlich ihre Lebensgeschichte, ihre Rolle? Wie hat ihre Tätigkeit als Sammler unsere Auffassung der Kunstgeschichte beeinflusst, weil die Werke noch da sind? So ein bisschen Fokus weg von nur Bührle, aber was hat zuvor stattgefunden?
Und gleichzeitig auch zu sagen:Ja, ein Teil dieser Werke, wenn wir sie erforscht haben, ein Teil ist schon nicht mehr unter Verdacht und die kann man auch präsentieren mit Fokus auf der Künstler selber oder auf das Kunstwerk selber. Aber ob sie dann befreit sind, das denkt diese ganze Diskussion, um Bührle herum wird ewig Teil sein dieser Bilder, aber ich glaube, man kann Schritt für Schritt neue Dimensionen eröffnen. Und was dann der Schritt ist, wieder nach diese drei Ausnahmen. Das sind drei Ausnahmen über jüdische Sammler, über Kunst und dann eine Dauerpräsentation über die ganze Debatte. Was danach kommt, das, glaube ich, können wir jetzt noch nicht vorher sehen, weil in diese drei Jahren, dass ich hier bin, hat die ganze Diskussion, wie Herr Magnaguagno gesagt hat, hat sich schon so geändert. In drei Jahren ist es wieder völlig anders und dann muss man reagieren auf die gesellschaftliche Lage in diesem Moment.
Herr Magnaguagno, ihr Schlusswort:Wie löst man das Problem? Ja, also ich weiß es ganz sicher nicht. Also meine Position war ja immer einfach: Return to the Sender. Das habe ich auch gesagt, da in diesem Resonanzraum und so, und ich bleibe dabei. Ich glaube nicht, dass das Kunsthaus Zürich diese Sammlung braucht. Es war von Anfang an ein Marketing-und Tourismusprojekt und über die Qualität der Bilder könnte man auch endlich mal lange streiten. Gut. Wir brauchen es nicht. Sie sind auf jeden Fall konsequent. Ich danke Ihnen ganz herzlich für diese Debatte. Man könnte noch lang weiter reden. Ja, ja, genau. Er ist wirklich endlos. Ja, danke.