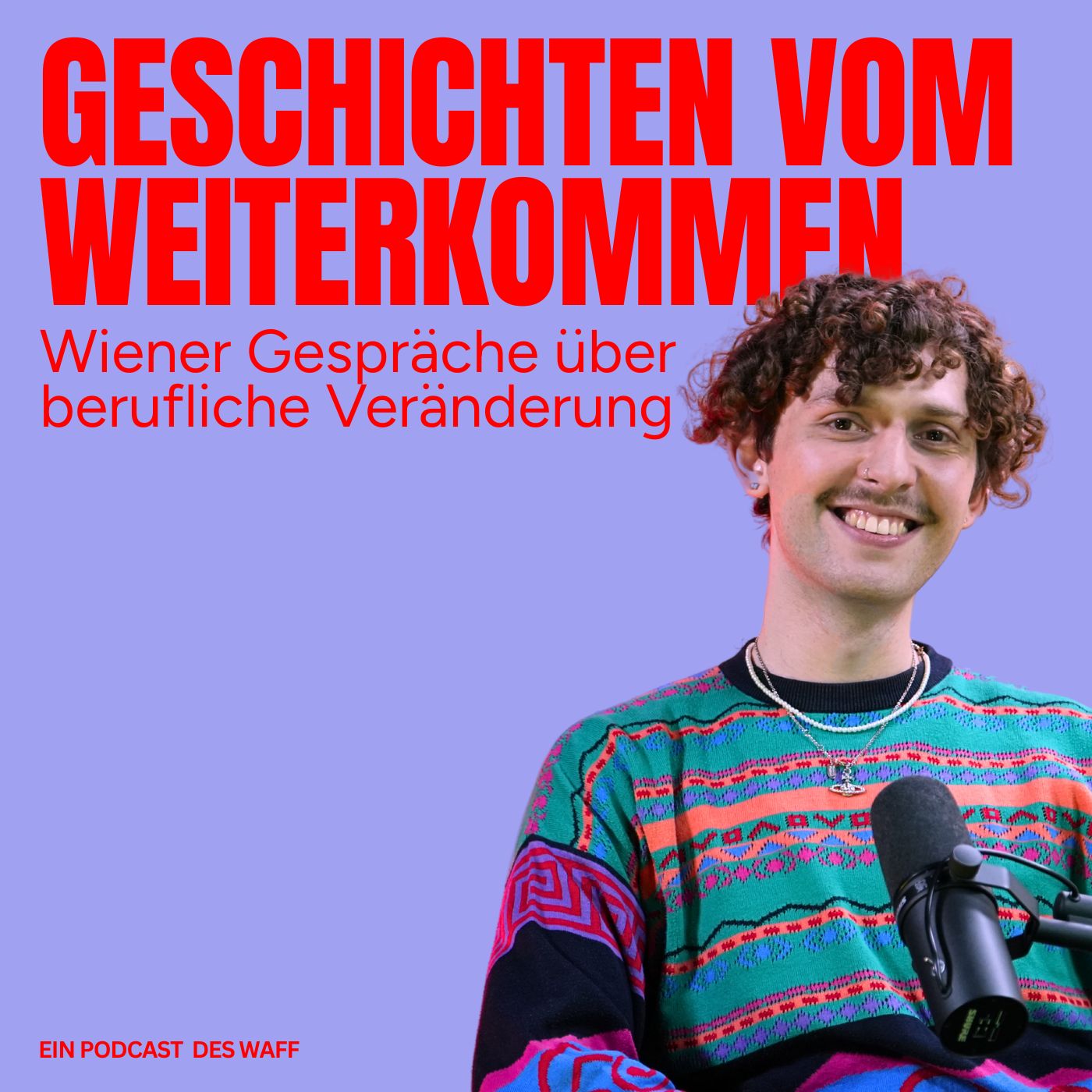Stadt Wien Podcast
Stadt Wien Podcast
Mit Strategie zu mehr Demokratie und Beteiligung
Am Mittwoch hat der Gemeinderat die erste Wiener Demokratie-Strategie beschlossen. Wie das Leitdokument Mitbestimmung und Teilhabe stärker in den Alltag der Menschen bringen und die demokratische Kultur in der Stadt langfristig festigen soll bespricht Christine Oberdorfer mit Demokratiestadtrat Jürgen Czernohorszky und Wencke Hertzsch, der Leiterin des Büro für Mitwirkung.
Die Wiener Demokratie-Strategie: https://www.wien.gv.at/spezial/demokratie-strategie/
Die Beteiligungsplattform der Stadt Wien: https://mitgestalten.wien.gv.at/
Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr unseren Podcast bewertet und abonniert (falls ihr das noch nicht gemacht habt).
Feedback könnt ihr uns auch an podcast(at)ma53.wien.gv.at schicken.
Folgt uns auf unseren Social Media Kanälen:
https://www.facebook.com/wien.at
https://bsky.app/profile/wien.gv.at
https://twitter.com/Stadt_Wien
https://www.linkedin.com/company/city-of-vienna/
https://www.instagram.com/stadtwien/
Und abonniert unseren täglichen Newsletter:
http://wien.gv.at/meinwienheute
Weitere Stadt Wien Podcasts:
- Historisches aus den Wiener Bezirken in den Grätzlgeschichten
- büchereicast der Stadt Wien Büchereien
-Mehr Menschen für Beteiligung begeistern, die Wünsche und Ideen der Stadtbewohnerinnen und Stadtbewohner berücksichtigen und Demokratie in den Alltag holen, das sind die Ziele der Wiener Demokratiestrategie, die gerade im Gemeinderat beschlossen wurde. Warum eine solche Strategie nötig ist und was das in der Praxis heißt, frage ich Wencke Hertzsch, Leiterin des Büros für Mitwirkung und Demokratiestadtrat Jürgen Czernohorszky. Herzlich willkommen bei uns im Podcaststudio.-Danke für die Einladung.-Schön, dass ich da sein darf.-Dankeschön. Wo beginnt denn für euch Demokratie? In der Familie, in der Schule? Wo startet es?-Ich würde sagen, Demokratie beginnt unmittelbar um einen herum, nämlich genau dort, wo man nicht allein sein muss, sondern mit anderen gemeinsam die Welt, seine eigene Lebensumgebung oder eben die Stadt, das Grätzl, gestalten möchte. Insofern ist Demokratie überall und das ist auch gut so, weil es eine Grundlage dafür ist, ein gutes Leben zu führen. Wien ist eine Stadt, die den Anspruch stellt, dass alle ein gutes Leben führen. Das bedeutet natürlich, dass wir irrsinnig viel daran arbeiten müssen, dass die materiellen Rahmenbedingungen dafür da sind, dass man sich Wohnungen leisten kann, dass man mit dem öffentlichen Verkehr überall hinkommt, dass man sich ein gutes Leben eben leisten kann und das in jedem einzelnen Bezirk. Aber es bedeutet auch, dass man mittun kann bei der Stadt, mitgestalten kann, mitreden kann, gehört wird und den Eindruck hat, man ist eben nicht allein. Insofern ist Demokratie zu Hause, im Park, im Grätzl. Genauso wie im Gemeinderat.-Wie sehen Sie das?-Für mich beginnt Demokratie auch im Alltag. Also da, wo sich Menschen treffen, zuhören, sich gegenseitig ernst nehmen, auch zu gemeinsamen Entscheidungen kommen oder halt irgendwie auch Kompromisse finden müssen. Und das ist halt jede kleine Alltagssituation. Das kann in der Familie sein, wo Entscheidungen getroffen werden müssen über die Urlaubsplanung. Was gibt es zum Frühstück? Was muss auf die Pizza drauf? Aber es kann genauso gut am Arbeitsplatz sein. Schule, in der Nachbarschaft sein. Also da, wo sich Menschen austauschen, begegnen, beginnt Demokratie.-In der Demokratiestrategie steht ganz zu Beginn, Demokratie steht unter Druck. Was meint ihr denn da damit?-Naja, ich bin der traurigen Überzeugung, dass Demokratie als die Form, wie wir unser Leben gemeinsam regeln, in Freiheit, in Gleichheit, das heißt im Bewusstsein, dass jeder Mensch die gleichen Rechte haben soll, gleich an Würde ist, dass diese Form, das Leben zu regeln, angegriffen wird. Einmal von außen, würde ich so sagen, von vielen Demokratiefeindinnen und-feinden, die wirklich darauf aus sind, eine Wende einzuleiten in Richtung eines autoritäreren Staates. Wir sehen das beispielsweise in den USA, wo Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen verfolgt werden, wo Leute ohne Verfahren abgeschoben werden, wo in den Städten das Militär eingesetzt wird, um Demonstrationen niederzuwerfen. Da sieht man schon, das fühlt sich nicht mehr nach Demokratie an. Aber der Weg dorthin, der beginnt schon, wenn immer Menschen nicht für gleichwertig gesehen werden, Menschen heruntergemacht werden, gehetzt wird. Und das ist ja auch in Österreich der Fall. Also dem muss man etwas entgegensetzen, indem man Demokratie verteidigt. Und verteidigen geht am besten dann, indem man es lebt und indem man darüber nachdenkt, wie kann es sich gut anfühlen. Für jede und jeden Einzelnen. Und da bin ich bei der zweiten Gefahr für die Demokratie, wenn man so will, von innen. Ich fürchte, sehr viele Menschen, auch in Österreich, haben das Vertrauen verloren, dass Politik, dass Demokratie ihre Probleme löst. Es gibt einfach riesengroße Herausforderungen für jede Wienerin, jeden Wiener. Kann ich mir das Einkaufen gehen leisten? Wird die Zukunft eine Zukunft in Frieden sein für meine Kinder? Haben meine Kinder in Zukunft einen Job? Kann die Klimakrise so bekämpft oder kann man der so begegnen, dass man auch ein gutes Leben in Zukunft führt in der Stadt? Und wenn dann der Eindruck besteht, die Regeln, die wir da finden, die Art, wie wir das ausdiskutieren, wie wir Möglichkeiten finden, als Staat oder Stadt darauf zu reagieren, das funktioniert irgendwie so nicht, dann ist das auch eine Gefahr für die Demokratie. Und auch da gilt, dem entgegensetzen kann man eigentlich nur funktionierende Demokratie. Also indem man es macht, ausprobiert, erlebt, den Eindruck hat, ich selbst bin wirksam, ich werde gehört, meine Probleme werden ernst genommen. Und da ist eigentlich der Grundgedanke hinter unserer Wiener Demokratiestrategie auch der, dass sich Demokratie weiterentwickeln muss. Weil Demokratie ist nicht einfach da, die macht man. Und das bedeutet, neben dem Fundament der repräsentativen Demokratie, das sehr zentral ist und auch unser Fundament für die Art und Weise, wie wir Regeln ausmachen ist, braucht es immer wieder Demokratieinnovationen, die Möglichkeiten schaffen, eben im Grätzl, in seinem unmittelbaren Lebensumfeld in Wien auch eine Rolle zu spielen, mitzutun, mit der Stadt gemeinsam Lösungen zu finden. Und das gemeinsam kann, glaube ich, Wien zu einem Ort machen, aus dem heraus eine Demokratiebewegung entsteht. Also das gemeinsam Dinge tun, Spaß macht und Probleme löst. Und so geht das dann auch mit dem Druck, unter dem die Demokratie steht, so können wir dem begegnen.-Da setzen Sie ja in Ihrer Arbeit auch in die Praxis um. Wie ist Ihr Eindruck? Ist Demokratie gefährdet? Wo sind denn da die Reibungspunkte?-Ja, es ist schon angeklungen. Ich finde eben, Demokratie fällt nicht einfach vom Himmel und in unseren Schoß und ist halt irgendwie Gott gegeben. Sondern Demokratie bedeutet halt auch Arbeit, bedeutet Auseinandersetzung, bedeutet halt, dass es gestärkt werden muss, muss entwickelt werden und muss halt auch immer wieder an die Rahmenbedingungen und an die gesellschaftlichen Herausforderungen angepasst werden. Und deswegen ist halt auch die Demokratiestrategie für uns aus der Verwaltungsperspektive ein wichtiger Rahmen und eine wichtige Orientierung, die uns Demokratieentwicklung, Beteiligung, Mitbestimmung auch langfristig absichert. Für alle Lebensbereiche und für sehr viele unterschiedliche Zielgruppen. Und das ist sozusagen, das soll die Demokratiestrategie auch erfüllen. Sie soll den Rahmen geben und die Orientierung geben, dass für die Verwaltung, dass es sozusagen zur Selbstverständlichkeit wird, dass es Teil des Verwaltungshandels ist. Und sie soll aber auch natürlich flexibel sein, um auch auf zukünftige gesellschaftliche, gesellschaftliche Herausforderungen reagieren zu können. Aktuell haben wir in Wien auch die Herausforderung, dass ein Drittel der Wiener*innen nicht wahlberechtigt sind. In manchen Bezirken und Quartieren geht dieser Anteil bis zu 50 Prozent. Das sind Menschen, die wir auch adressieren, weil sie sozusagen, sie sind in einer repräsentativen Demokratie nicht repräsentiert. Aber sie haben sehr viele Möglichkeiten, trotzdem aktiv zu sein. Und da gilt es aufzuklären und auch die Möglichkeiten zu zeigen und auch den Rahmen zu bieten, dass diese Menschen auch sich einbringen können.-Da hat ja das Büro für Mitwirkung eine Schlüsselrolle. Wollen Sie uns kurz erzählen, was da so die Aufgaben, die zentralen Aufgabenstellungen sind?-Ja, als Büro für Mitwirkung verstehen wir uns als Drehscheibe zwischen Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft. Also uns geht es vor allem darum, halt sehr viele unterschiedliche Akteur*innen zu vernetzen in diesem Dreigespann. Und es geht uns auch darum, die Stadtverwaltung als Institution im Beteiligungsbereich weiterzubringen. Also das heißt, wir beraten Fachdienststellen und wir beraten aber auch Bezirke, dass Beteiligung und Teilhabe ein essentieller Bestandteil ihres Verwaltungshandels und ihrer Prozesse wird. Und auch sozusagen, wir arbeiten da halt eben auch gemeinsam an der Qualität. Und als Büro für Mitwirkung entwickeln wir aber auch eigene Formate. Der Beteiligung, die einen sozial inklusiven Anspruch haben, wo es genau darum geht, in unserer Sprache heißt das, die schwer erreichbaren Zielgruppen zu erreichen, aber genau jene Stimmen zu hören, auch in einer gesellschaftspolitischen Perspektive, die weniger gehört werden. Das heißt, da brauchen wir neue Zugänge, neue Formate, neue Herangehensweisen, um diese Stimmen auch zu hören. Und da setzt das Büro für Mitwirkung an.-Sie möchten möglichst viele Menschen und Ziele, Zielgruppen motivieren, sich zu beteiligen. Wie soll denn das gelingen und was wurde denn da bisher schon getan? Vielleicht beginnen wir bei Ihnen wieder.-Ja, vielleicht kann ich an das anknüpfen, was Wencke Hertzsch vorher gemeint hat, mit dem großen Ausschluss, den wir in Wien auch bewusst zum Thema machen wollen und gegen den wir ankämpfen wollen, auch auf Bundesebene. Das Thema der Nichtrepräsentation der Nichtstaatsbürgerinnen und Staatsbürger. Wenn man sich das ein bisschen genauer anschaut, diese 33 Prozent circa, die in Wien nicht wählen dürfen, weil sie, obwohl sie im wahlfähigen Alter sind, hier leben, arbeiten, Steuern zahlen, oft auch hier geboren sind. Da gibt es noch eine zweite Zahl oder eine zweite ziemlich dramatische Realität dahinter. Wenn man nämlich schaut, wie unterschiedliche Bevölkerungsgruppen betroffen sind, dann sind das beispielsweise 60 Prozent der Arbeiterinnen und Arbeiter, 80 Prozent der Hilfsarbeiterinnen und Hilfsarbeiter. Warum sage ich das? Man sieht, hier gibt es eine soziale Komponente. Das liegt jetzt in dem Fall, was das Staatsbürgerschaftsrecht in Österreich betrifft, daran, dass Hürden eben finanzielle Hürden sind und wirklich dramatisch genau jene treffen, die eben weniger Geld haben, aber eine zentrale Rolle spielen dafür, dass unser alltägliches Leben funktioniert, ob das jetzt in der Pflege ist oder ob die Leute im Bau arbeiten oder in der Reinigung. Aber die Sozialkomponente gibt es überall und die wollen wir uns genau anschauen. Wer beteiligt sich jetzt nicht, einfach weil er oder sie die Rahmenbedingungen nicht hat? Wenn ich den ganzen Tag arbeiten muss, schuften muss, um alleinerziehend meine Kinder durchzubringen und dann am Abend nach Hause komme, dann habe ich einfach keine Lust mehr, an einem komplizierten Beteiligungsverfahren mitzumachen, um ein Beispiel zu nennen. Und deshalb machen wir uns sehr, sehr viele Gedanken darüber, wie können wir das so niederschwellig wie möglich machen. Ein Beispiel ist, einfach dorthin zu gehen, wo die Leute sind. Beim Klimateam, das ist ein wirkliches Vorzeigemodell des Auf-die-Menschen-Zugehens und mit den Leuten in Wien gemeinsam etwas zu machen, ist uns das sehr gut gelungen, weil wir eben im Park sind oder mit Multiplikatorinnen und Multiplikatoren zusammenarbeiten. Das kann der Wirt sein ums Eck oder der Jugendarbeiter, die Jugendarbeiterin im Park oder die Hausbesorgerin oder mit Communities unterschiedlicher Religionsgemeinschaften. Wir haben da große Erfolge erzielt. Wir haben 2023 eine Evaluierung gemacht dieses Projekts und da hat sich herausgestellt, 60 % der Leute, die dort mitgemacht haben, haben vorher noch nie bei einem Beteiligungsprojekt mitgemacht. Jetzt finde ich, das an sich ist ein super Beispiel dafür, dass es direkte Folgen hat, wenn man auf etwas genau schaut. Und in dem Fall wollen wir genau darauf schauen, dass gerade die Leisen eine Stimme bekommen, dass wir laut sind für die Leisen, dass wir die Möglichkeiten nutzen, dass wir, ob das Sprache ist, die Bildsprache ist, das Herausgehen, das Herannahen an die Menschen, mit ihnen gemeinsam was zu arbeiten, ob das vielleicht das Hinterfragen ist von recht komplexen Systemen, die wir teilweise in der Stadt haben oder ob das einfach das Miteinander tun, statt alleine eine Meinung einbringen müssen ist. Alle diese Möglichkeiten, die wollen wir ergreifen, damit wir ganz besonders ernst nehmen, was die Grundlage für das Demokratiejahr, in dem wir gerade ja sind, wenn es Demokratiehauptstadt ist, jede Stimme zählt. Und darum geht es.-Was wird denn bisher schon getan, um diese Zielgruppen besser zu erreichen? Klimateam haben wir jetzt gerade schon gehört.-Genau. Die Stadt Wien ist in dem Bereich schon sehr breit aufgestellt. Es gibt da schon sehr viele verschiedene Angebote. Also wenn ich an die lokale Agenda 21 denke, die Grätzllabore, die Grätzloasen oder halt irgendwie auch die Gebietsbetreuung, die Wohnpartner.-Da geht es viel um Stadtplanung. Stadtgestaltung, oder?-Genau. Da geht es um Gemeinwesenarbeit und halt irgendwie auch, da geht es um die Nachbarschaften und es geht halt auch um Stadtentwicklung. Und überall da werden halt natürlich Zugänge ausprobiert. Und mit dem Wiener Klimateam beispielsweise haben wir nochmal versucht, neue Ansätze halt auch zu vertiefen, um halt irgendwie genau diesen Umstand, den wir gerade auch schon besprochen haben, Menschen zu erreichen, die bis dahin keine Beteiligungserfahrung haben. Oder die, die sozusagen bisher nicht gehört wurden, stärker einzubringen. Und da ein System, mit dem wir da auch im Wiener Klimateam gearbeitet haben, neben den vielen aufsuchenden Arbeiten, ist auch die Bürger*innen-Jury. Das ist ein repräsentatives Losverfahren, wo wir das Zufallslos auch entscheiden lassen, wer Teil einer Bürger*innen-Jury wird. Und da haben wir, das haben wir auch evaluiert und da sehen wir beispielsweise auch, dass wir darüber halt eben gerade Menschen erreichen, die kein Wahlrecht haben in Wien. Und auch aus den Gesprächen mit diesen Menschen, die jetzt mittlerweile an den Bürger*innen-Jurys in der Vergangenheit wahrgenommen haben, das macht was mit diesen Menschen, wenn sie direkt angesprochen werden, direkt adressiert und eingeladen werden, Teil eines Entscheidungsprozesses zu sein und sich sozusagen gemeinsam mit anderen im Rahmen des Wiener Klimateams beispielsweise halt eben für Projekte des Klimaschutzes zu entscheiden. Weil sie vorher diese Erfahrung nicht gemacht haben, dass ihre Stimme und ihre Meinung halt irgendwie zählt und gefragt ist.-Erklären Sie es mal ganz kurz, weil wir jetzt schon relativ lang darüber gesprochen haben, was ist das Klimateam?-Das Wiener Klimateam ist ein großes Mitmachprojekt der Stadt Wien, was wir seit 2022 umsetzen, wo Ideen für den Klimaschutz für Wien in den Grätzl und Bezirken gesucht werden. Es läuft durch mehrere Phasen. Es ist ein einjähriger Beteiligungszyklus und aus den Ideen werden Projekte entwickelt mit den Menschen in den Bezirken, mit der Stadtverwaltung gemeinsam in ko-kreativen Prozessen und am Ende entscheidet eben eine Bürger*innen-Jury über die Auswahl der Projekte, welche umgesetzt werden in den Bezirken. Und dafür steht ein Umsetzungsbudget zur Verfügung in jedem Bezirk von 20 Euro pro Bezirksbewohner*in.-Danke. Die Klimakrise ist ja auch als eine Herausforderung in der Demokratiestrategie genannt. Wie hängen denn Klima und Demokratie zusammen? Warum kommt das Thema Klima in einer Demokratiestrategie vor? -Ich würde sagen, weil es ein gutes Beispiel dafür ist, ich würde sogar sagen eines der größten Beispiele dafür, dass sich eine Stadt weiterentwickeln muss. Dass wir die laufende Stadt umbauen müssen, also transformieren, damit sie auch in Zukunft ein guter Ort zum Leben ist. Und da ist es bei der Klimakrise schlicht und einfach so, dass durch die heißer werdenden Sommer, durch mehr Trockenheit, wir unsere Stadt an sich umbauen müssen. Wir brauchen mehr Schatten. Wir müssen schauen, dass unsere Wohnungen im Sommer so saniert sind oder so isoliert sind, dass man durchschlafen kann, auch wenn es sieben, acht, neun Tage heiß ist. Weil in den Wohnungen, da bildet sich ja Lebensqualität ab. Da erziehen wir unsere Kinder. Da lernen wir. Da arbeiten wir. Und wir schlafen dort. Und das Gleiche gilt für den Grünraum. Den brauchen wir, um einfach eine gute Luft zu haben, Schatten zu haben, draußen sein zu können, wenn man keinen Dachgarten oder keinen Balkon hat. Das heißt, wir bauen unsere Stadt um, damit Wien ein guter Ort zum Leben ist. Das ist in der Wiener DNA, dass wir nicht eine Stadt sind, wo sich quasi nur die, die sich es richten können, irgendwie gut gehen lassen, sondern alle. Und wenn man was umbaut, dann macht es natürlich Sinn, dass man das gemeinsam macht. Wenn man auch gemeinsam dann genau dort leben möchte, in einer Stadt, in diesem Zuhause. Und vielleicht ist das auch ein gutes Beispiel dafür, was wir meinen, wenn wir Möglichkeiten der Mitbestimmung finden wollen. Wenn ich eine Wohnung beziehe und ich möchte die, oder ich muss die ausmalen. Vielleicht muss man auch ein paar Löcher in der Wand ausputzen etc. Wenn ich das zwei, drei Tage hintereinander alleine mache, kann man machen. Fühlt sich irgendwie ein bisschen anstrengender an. Ich kann mich mit niemandem beraten. Soll die Farbe eher den Ton haben oder den Ton haben? Wenn ich das mit zwei oder drei Freunden gemeinsam mache oder mit meiner Familie, dann fühlt sich das eigentlich schon wie eine Sache an, die nicht einmal anstrengend ist, sondern vielleicht sogar Spaß machen kann, die aber jedenfalls sicherstellt, alle, die da gemeinsam mittun, die haben dann nachher auch Stolz daran, die leben dann auch in dieser Wohnung gerne gemeinsam. Und das gilt eigentlich auch für die Stadt. Gemeinsam machen, gemeinsam ändern, weil wir wollen sie auch gemeinsam bewohnen.-Wir haben schon über eine Zielgruppe gesprochen die in Wien jetzt rein politisch kein Mitspracherecht hat, das heißt die Menschen, die nicht wahlberechtigt sind. Wie sieht es denn mit Kindern und Jugendlichen aus? Die können ja auch nicht wählen, zumindest mal bis 16. Was können denn die tun? Welche Möglichkeiten haben die, um ihre Lebenswelt mitzugestalten?-Ja, auch für die Kinder und Jugendlichen soll das kein theoretisches Konstrukt sein, Demokratie, sondern einfach auch erlebbar sein in ihrem Alltag. Gibt es beispielsweise die Jugendparlamente, da kann man sich jetzt noch diese Woche bewerben für die neuen Jugendparlamente und Teil des Jugendparlaments werden. Wir haben in der Stadt auch die Kinder- und Jugendstrategie verabschiedet, jetzt im September, soweit ich mich erinnere, wo einfach auch die Teilhabe- und Beteiligungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche einfach auch als rahmengebend für die Stadtverwaltung festgelegt werden in den verschiedenen Themenbereichen, die sie halt auch betreffen, wenn es um den öffentlichen Raum geht oder wenn es halt irgendwie auch um ihr direktes Schulumfeld geht. Dort ist sozusagen halt irgendwie auch langfristig ihre Beteiligung und Teilhabemöglichkeit verankert und was halt auch auf Bezirksebene sukzessive oder halt in Gestaltungsprozessen durch die Dienststellen sukzessive umgesetzt wird. Die nächsten Jahre wird es einen großen Schwerpunkt geben, auch für Kinder und Jugendliche, sich noch stärker in Beteiligungsprozesse, wenn es um die Umgestaltung der Stadt geht, einzubeziehen. Auch das ist in der Kinder- und Jugendstrategie verankert und da wird es in Zukunft noch mehr Projekte und Maßnahmen geben.-Haben Sie da Praxisbeispiele?-Das Praxisbeispiel beispielsweise ist im Rahmen der lokalen Agenda 21. Tik-Tak Galilei ist ein Projekt gewesen, wo auch Kinder und Jugendliche, soweit ich weiß, mitgearbeitet haben, wo es um die Umgestaltung einer Straße in einen verkehrsberuhigten Bereich geht. Im Rahmen des Wiener Klimateams auch arbeiten wir immer wieder mit Schulen gemeinsam, wo wir mit Schüler*innen Ideen entwickeln, auch in der Vergangenheit, die dann auch bis zur Umsetzung gekommen sind. Es wird jetzt in Floridsdorf beispielsweise ein Projekt für Kinder und Jugendliche umgesetzt, wo es um die Bewusstseinsbildung geht, für Schüler*innen in Floridsdorf zum Thema Klimaschutz. Das ist ein Klimateam-Projekt, was jetzt in die Umsetzung kommt.-Thema Kinder und Jugendliche, das war ja auch mal Ihr Schwerpunkt.-Es ist es immer. Ist es immer.-Ist es immer noch.-Ja, vielleicht ist die Arbeit der Stadt an der Kinder- und Jugendstrategie, die ja jetzt gerade fortgeschrieben worden ist und im Gemeinderat beschlossen worden ist, auch ein gutes Beispiel für breiteste Beteiligung. Damals gab es die Werkstadt Junges Wien, wo über 20. 000 junge Wienerinnen und Wiener mitgemacht haben beim Auftrag geben an eine Stadt mit dem Ziel, dass diese Stadt eine kinder- und jugendgerechte Stadt wird oder die kinder- und jugendfreundlichste Stadt der Welt. Das war das Ziel. Und eben diese Strategie dann ist, so wie die Demokratiestrategie auch, ein Auftrag für uns in der Stadt. Das betrifft natürlich alle Ressorts. Gerade bei der Kinder- und Jugendstrategie war es so, dass sehr viele Kinder und Jugendliche das Thema Grünraum angesprochen haben. Irgendwie logisch, weil junge Leute halten sich im Freien auf. Ob das jetzt Kinder sind, die einen guten Spielplatz brauchen oder Naschhecken im Park gefordert haben oder eben Jugendliche sind, die einfach unter sich miteinander plaudern wollen und nicht einfach den Platz haben, ohne gleich etwas konsumieren zu müssen oder zu Hause bei den Eltern die Freizeit zu verbringen. Da gibt es irrsinnig viele Forderungen. Und das betrifft irgendwie die ganze Stadt. Und das von dir angesprochene Beispiel der Galileigasse am 9. ist auch so eins. Das war eigentlich eine Eroberung des öffentlichen Raums für Kinder und Jugendliche. Das war in der Corona-Zeit. Da war irgendwie die Notwendigkeit da, dass man einen Platz findet, wo man miteinander sein kann, wo mehr Leute als quasi zwei in einem Raum miteinander plaudern und lernen können. Und dann hat man einfach gesagt, okay, wir sperren mal diese Straße ab, machen da die Klasse draußen. Und dann ist es so sukzessive, auch mit der TU gemeinsam mit Studierenden, die da mitgemacht haben, zu einer wirklichen Oase geworden. Wo jetzt die Volkshochschule, also eine andere Bildungseinrichtung, mit der Volksschule gemeinsam eine riesengroße Straße, die mittlerweile angemalt worden ist, bepflanzt worden ist, mit Trögen etc. einfach bespielt und dafür einen Platz geschaffen hat für Kinder und Jugendliche. Mehr Platz ist insgesamt etwas, was sehr, sehr viele Forderungen betrifft, die Kinder einfach brauchen. Weil eine Stadt der Erwachsenen oft darauf vergisst, dass Kinder ganz schön viel Platz brauchen, um ein gutes Leben zu führen.-Die Digitalisierung ist ja auch so ein Thema, das nicht nur die Kinder und Jugendlichen, aber auch sehr stark die Kinder und Jugendlichen betrifft. Wenn es jetzt um das Thema Fake News, Social Media geht oder Informationsquellen, missbräuchlich genutzte KI, das sind ja lauter so Themen, die auch Kinder und Jugendliche sehr stark betreffen. Was ist denn da zu tun und welche digitalen Beteiligungsmöglichkeiten gibt es denn da?-Ja, der digitale Raum ist auch ein zentraler Ort, wo Meinungsbildung und Demokratie stattfindet. Und als Stadt hat man da natürlich auch den Auftrag, Orientierung zu bieten oder Transparenz zu schaffen, halt irgendwie für alle Themen und Projekte, die halt auch Stadt betreffen. Wir haben als Stadt eine zentrale Beteiligungsplattform, die Mitgestalten-Plattform der Stadt, wo wir digitale Beteiligungsangebote setzen. Wo es genau darum geht, auch Menschen einzuladen, Ideen einzubringen und halt aber auch auf dieser Plattform deutlich zu machen, was mit den Ideen passiert. Das ist sozusagen kein, soll kein Ideen-Friedhof sein, sondern über diesen Prozess, wie Ideen entwickelt werden, auch die digitalen Möglichkeiten gut zu nutzen, um darüber zu informieren, wie es eigentlich mit der Idee weitergegangen ist. Und dafür sind halt irgendwie auch digitale Räume da, um Nachvollziehbarkeit herzustellen und eben auch Transparenz herzustellen. Auch die Demokratiestrategie ist ein, es war ein großer partizipativer Prozess in der Entstehung, wo mehr als 500 Menschen beteiligt waren. Und es gab auch einen Moment, wo wir sozusagen uns dafür entschieden haben, den Erstentwurf, den Textentwurf der Strategie digital über eine digitale Beteiligungstool kommentieren und bearbeiten zu lassen. Das war erstmalig, ist ein Strategiepapier der Stadt im Rahmen eines digitalen Beteiligungsprozesses kommentiert worden. Und darum geht es auch, sozusagen solche Texte zur Verfügung zu stellen, in den Austausch zu kommen, aber auch gleichzeitig den digitalen Raum wiederum dafür zu nutzen, was mit diesen Anmerkungen und mit den Kommentaren passiert ist und das auch wieder zurückzuspielen. Und gleichzeitig brauchen wir aber natürlich Medienkompetenz und Bildung, damit halt Menschen und auch junge Menschen in der Lage sind, Informationen gut einordnen zu können und auch zu verstehen, was sozusagen halt in diesen Medien grundlegend passiert. Für uns ist digitale Beteiligung ein Add-on im Beteiligungsprozess, um halt einfach auch sozusagen Beteiligungsangebote ubiquitär, also zur Verfügung zu stellen und dass man halt viele Möglichkeiten hat, wenn ich eingeteilt bin, dass ich halt dann auch noch abends oder in der Früh oder mal nebenbei die Möglichkeit habe, mich einzubringen, wenn ich nicht zu einer Veranstaltung kommen kann. Es ist kein Ersatz für Präsenz und für aufsuchende Arbeit im Beteiligungsbereich, aber es ist eine wertvolle Ergänzung.-Stichwort Medienkompetenz. Wer hat denn da die Verantwortung, die Kinder da auch entsprechend zu schulen, die Familien, die Schulen, die Politik?-Alle, würde ich mal sagen. Das ist jetzt einfacher beantwortet, als es dann in der Umsetzung ist, weil es bedeutet ja wirklich, dass wir auf allen Ebenen uns da noch viel mehr Gedanken drüber machen müssen, wie wir dafür sorgen können, dass wir den digitalen Raum auf der einen Seite nutzen für das, was uns wichtig ist, nämlich eine starke Gemeinschaft, die sich Regeln miteinander ausmacht, die dafür sorgt, dass jede und jeder gehört wird. Aber im Umkehrschluss, dafür sorgen, dass dieser digitale Raum nicht verwendet wird, um das, was uns gemeinsam wichtig ist, eigentlich zu zerstören. Und das passiert schon auch und in den letzten Jahren sehr verstärkt. Es ist sicherlich so, dass eine weitere Gewalt im demokratischen Raum herangewachsen ist. Da sind die Fake News im Social-Media-Bereich oder auch die Tendenz, dass dort jede Art von Austausch sofort eine Polarisierung ist, wo man sich abgrenzt und wo man aber nicht mehr miteinander Lösungen sucht. Und das macht mir große Sorgen, weil ich auch wirklich glaube, dass es eine Gefahr, eine reale Gefahr ist. Es ist vielleicht nur digital und findet im Handy statt, aber es ist eine reale Gefahr für unseren Frieden, für unsere Sicherheit, für unser Zusammenleben. Und man sieht das eben beispielsweise in den USA, wo, wie ich, ich finde, etwas stattfindet, was man als Staatsstreich bezeichnen kann, in Richtung autoritärem System. Und das hat ganz viel mit digitalen Medien zu tun. Und wie dort von Elon Musk angefangen, Menschen im digitalen Raum beziehungsweise der digitale Raum selber verwendet wird, um das, was uns gemeinsam wichtig ist, zu zerstören und die Leute auseinander zu dividieren. Heißt, riesengroße Aufgabe. Das kann man in den Schulen adressieren. Muss man auch. Da ist es wichtig, dass man Räume schafft, wo man ohne den digitalen Raum einfach miteinander lernt und auskommt. Aber das reicht halt auch nicht. Man muss dann auch pädagogisch genau damit umgehen, mit Fake News, mit der Möglichkeit, so etwas zu erkennen. Darüber, wie man miteinander umgeht, auch wenn man sich Sachen schickt am Handy. Das betrifft genauso natürlich das Zusammenleben im Familienbereich. Ich finde, was wir als Stadt unabhängig davon tun können, ist dafür sorgen, dass der nicht-digitale Raum ein guter Ort ist, wo man gerne miteinander ist und gute Zeit miteinander verbringt. Das vergisst man vielleicht manchmal. Und man weiß es aber bei sich selber auch. Manchmal ist es eine Flucht oder eine Ablenkung von dem, was sonst schwierig ist. Und wenn man dafür sorgt, dass eine Stadt einfach ein gutes Zuhause ist, wo man miteinander eine gute Zeit verbringen kann, Lösungen für Probleme sucht, aufeinander trifft, miteinander isst, plaudert etc. dann ist das auch eine gute Schluckimpfung dagegen, dass wir uns in eine Welt fliehen oder uns in eine Welt begeben, wo es weniger Gemeinsames gibt und mehr Trennendes.-Und die digitalen Inhalte wichtiger sind als meine Nachbarin oder mein Nachbar vielleicht. Wien war heuer europäische Demokratiehauptstadt. Ist es noch bis Ende des Jahres. Was waren denn die Highlights bisher?-Die Demokratiehauptstadt ist ein einziges Highlight. Ich glaube, wenn ich es so runterbreche von den Aktivitäten, die wir jetzt umgesetzt haben, kann ich schon sagen, dass ein Highlight jedenfalls ist, dass es uns gelungen ist, ein großes Demokratienetzwerk aus ganz vielen unterschiedlichen Partner*innen aufzubauen. Das sehen wir zum einen, wir haben einen Veranstaltungskalender. Dort sind über 500 Veranstaltungen gelistet, wo wir auch sehr stark im Austausch mit anderen Kolleg*innen aus anderen Geschäftsgruppen und Abteilungen auch gekommen sind, uns da ausgetauscht haben. Und da ist wahnsinnig viel entstanden. Wir haben, es ist uns gelungen, im Rahmen des Demokratiejahres auch einen Fördertopf aufzulegen von 300.000 Euro, wo wir Projekte, zivilgesellschaftliche Projekte, Kleinstprojekte unterstützt haben, wir haben knapp 300 Einreichungen bekommen. Das ist ein Riesenerfolg, wo wir sehen, dass der Bedarf natürlich auch sehr hoch ist, dass es sehr viele Ideen gibt.-Sagen Sie uns ein, zwei davon.-34 Projekte sind insgesamt umgesetzt worden. Und ein Projekt ist zum Beispiel, da wird gemeinsam aus Stoffresten ein Teppich geknüpft. Da kommen Menschen zusammen aus unterschiedlichen sozialen Gruppen, um gemeinsam an einem Produkt zu arbeiten. Es gab einen Bürger*innenrat zum Thema, Medien, der damit unterstützt werden konnte. Der Mila-Mitmach-Supermarkt ist ein Projekt, was unterstützt werden kann. Medienbildung, wir haben vorher darüber gesprochen, für junge Frauen ein Projekt, was unterstützt wurde. Man kann sich das alles bei uns auf der Seite anschauen.-Die heißt wie? -Die heißt mitwirkung.wien.gv.at und da kommt man dann sozusagen hin. Wir waren auch im Rahmen des Demokratie-Hauptstadtjahres eine Bühne eines internationalen Austauschs. Es hat die European City Conference Anfang des Jahres stattgefunden mit europäischen Städtepartner*innen, mit osteuropäischen Städtepartner*innen. Die Innovation in Politics Awards haben hier stattgefunden oder die Act Now Mayors Conference. Das ist auch insofern wichtig, auch einen Raum mit internationalen Expertinnen zu haben und auch mit anderen Städten sich da auszutauschen und Erfahrungen ins Gespräch zu kommen über Ansätze in anderen Städten und Ländern. Also da war schon viel dabei.-Was bleibt von der Demokratie-Hauptstadt Wien?-Ganz viele wunderbare Erlebnisse, wo wir von anderen Städten lernen konnten. Das ist eine Idee auch hinter diesem Netzwerk der Demokratie-Hauptstädte, das ja entsteht, weil jedes Jahr kommt eine neue dazu. Voneinander lernen und darüber nachdenken, ob man nicht vielleicht die eine oder andere Sache auch einfach abschauen kann, wenn es darum geht, dass man neue Projekte startet. Das bleibt einmal auf jeden Fall. Zweitens bleibt, dass wir sehr viele Dinge auch in die Welt hinaus getragen haben von den Dingen, die wir in Wien machen. Aber das uns Wichtigste ist natürlich Nachhaltigkeit. Wir haben uns sehr bemüht, dass wir Projekte mit dem Demokratie-Hauptstadtjahr in den Start bringen, die dafür sorgen, dass wir Demokratie insgesamt anders, neu mit vielen Innovationen in Wien angehen können. Das wichtigste Beispiel für diese Institutionalisierung ist sicher das Büro für Mitwirkung selbst. Das ist, wenn man so will, die MA Demokratie. Jetzt gibt es innerhalb der Stadt Verantwortliche, die sich um das Entwickeln von Demokratieprojekten kümmern, um das Standard setzen, wenn es eben um Beteiligung geht, eben ein solcher Standard ist. Es sollen wirklich alle mit tun können und da soll es keine Hürden geben, die selber Teil von einer Community of Practice sind. Das heißt mit NGOs, mit der Zivilgesellschaft gemeinsam diese Stadt bereichern. Und dieser Ort für Demokratie-Innovation innerhalb der Stadt, der hat jetzt auch eine klare Strategie, die Wiener Demokratie-Strategie. Das Ziel war, gemeinsam in diesem sehr, sehr langen Prozess, wo sehr viele Leute mitgetan haben, einfach einen Rahmen zu setzen, der sicherstellt, wir haben da jetzt ein Update, ein neues Level der Arbeit, die die Stadt Wien selber leistet dafür, dass es mehr Mitbestimmung, mehr Mitbeteiligung, mehr gemeinsames Anfühlen von der Stadt gibt, mit sehr, sehr vielen Einzelaufgaben. Das heißt, auf der einen Seite gibt es jetzt Verantwortliche, noch mehr als davor, weil es gibt natürlich in der ganzen Stadt sehr, sehr viele Partner. Und auf der anderen Seite haben die jetzt eine richtig, richtig große To-Do-Liste. Und diese To-Do-Liste heißt Wiener Demokratie-Strategie.-Wenn wir von Demokratie sprechen, kommt man ja auch um die Transparenz nicht herum. Wie transparent ist denn die Stadt Wien in ihren Entscheidungen und Maßnahmen? Und wo kann ich mich denn da informieren, wenn ich wissen will, warum etwas wie gemacht wird?-Jetzt einmal, grundsätzlich ist Wien eine Stadt, die sich sehr bemüht, alles zu tun, um den Bürgerinnen und Bürgern Rechenschaft abzulegen. Wir sind nicht umsonst viermal von Transparency International als die umsonst viermal Transparency International. Wir sind Transparency International. transparentes, die Stadt in Österreich ausgezeichnet worden. Das fängt an bei Open-Data-Plattformen, wo man einfach nachschauen kann, auf welchem Datenschatz die Stadt verfügt und geht bis zur Sag's-Wien-App, wo man eben relativ schnell in einem direkten Austausch mit der Stadt sein kann. Aber es ist natürlich auch ein Standard, den wir setzen wollen und eigentlich dort besonders setzen müssen, wenn wir Menschen einbinden, beteiligen, wenn wir miteinander tun. Und ein Beispiel ist dafür, dass etwa bei den Klimateams, wo ja tausende Ideen über die letzten Jahre gesammelt wurden, in den neun Bezirken, die mitgemacht haben, jede einzelne Idee nachvollziehbar ist und jeder Weg dieser einzelnen Idee. Da wird ja dann mit Expertinnen und Experten gearbeitet, daraus ein Projekt zu machen. Dann wurde dieses Projekt genauer ausformuliert. Dann hat eine Jury entschieden, machen wir. Oder das machen wir nicht, weil uns ein anderes Projekt wichtig ist. Das kann man alles nachvollziehen. Und Ähnliches gilt für das Entstehen der Wiener Demokratiestrategie. Das ist eben schon ein großer Schatz, den digitale Plattformen dafür bieten können. Es ist eben eine Unterstützung, sichtbar zu sein für alle bei dem, was man macht. Weil gerade bei Projekten des Miteinander-Tuns ist es halt oft so, dass man nicht immer Zeit hat, dabei zu sein. Und da muss es schon möglich sein, dass die Bürgerinnen und Bürger, so wie man digital eine Gemeinderatssitzung zu Hause anschauen kann oder nachschauen kann, auch solche Prozesse nachvollziehen können.-Geben Sie uns vielleicht noch abschließend einen kleinen Ausblick auf das kommende Jahr. Was hat denn das Büro für Mitwirkung so am Plan? Was gibt es für konkrete Maßnahmen in nächster Zeit?-Also ich glaube, das Hauptziel, was wir verfolgen, ist im nächsten Jahr, dass wir die Demokratie im Alltag noch stärker erleben wollen mit ganz vielen verschiedenen Partner*innen und ganz vielen verschiedenen Menschen, Zielgruppen, sozialen Gruppen. Und das heißt, wir werden unsere aufsuchenden Formate, wir haben jetzt die Werkstatt für Mitwirkung die letzten zwei Jahre auch ausprobiert und sind da ein sehr, wir sind im Schwimmbad dieses Jahr gewesen, um mit Menschen Demokratie-Fitness zu üben.-Wie übt man sowas?-Ja, für die Demokratie-Fitness, man braucht halt ja auch verschiedene Muskeln, die immer wieder trainiert werden müssen. Man braucht den Mutmuskel, den Neugiermuskel, den Streitmuskel, den Empathie-Muskel. Und das sind alles Skills und Kompetenzen, die man immer wieder trainieren muss. Wir haben da ein innovatives Konzept aus Dänemark nach Wien geholt. Es gibt jetzt über 60 Demokratie-Fitness-Trainerinnen Demokratie-Fitness-Trainerinnen in Wien, die dieses Konzept auch umsetzen können und mit ihren Zielgruppen, mit ihren Menschen, mit denen sie arbeiten, Demokratie-Fitness üben. Das werden wir weiter ausbauen. Und das heißt, auch wir werden mit diesem Programm und mit unserer Werkstatt für Mitwirkung noch… Wir werden an vielen verschiedenen Orten in Wien unterwegs sein, in den Vereinen, im öffentlichen Raum, vielleicht auch wieder im Freibad, wir werden sehen. Das ist, um eben die Demokratie zu den Menschen zu bringen, wo sie ihren Alltag verbringen, so wie wir es schon gesagt haben. Und auch die Demokratiestrategie jetzt mit dem Beschluss sind wir schon inmitten der Umsetzung. Die Umsetzung ist ein immerwährender Prozess. Wir werden mit den Kolleg*innen aus den verschiedenen Geschäftsgruppen jetzt sondieren, welche Maßnahmen als Nächstes umgesetzt werden. Das ist auch ein Prozess, den wir begleiten bis zur Umsetzung und auch zur Monitoring der Demokratiestrategie. Das wird ein großer Schwerpunkt sein. Und wir werden, ich habe es ja schon gesagt, als Büro beraten wir ja auch Dienststellen und auch Bezirke. Wir werden den Schwerpunkt der Beratung der Bezirke im nächsten. Jahr weiter ausbauen.-Welche zwei, drei Punkte aus der Demokratiestrategie hätten Sie gern oder würden Sie gern umgesetzt sehen im kommenden Jahr?-Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es im kommenden Jahr sein kann. Okay, ich antworte vorher auf den zweiten Teil der Frage. Kommendes Jahr ist es sehr wichtig, dass wir gemeinsam die Werkzeuge schaffen, dass wir die Demokratiestrategie wirklich umsetzen, monitoren können. Das heißt, dass sie in die ganze Stadt getragen wird. Da geht es darum, dass alle Geschäftsgruppen beteiligt sind. Also alle Stadträtinnen und Stadträte können ja was dazu beitragen. Ob das jetzt Demokratie, Beteiligung in Nachbarschaft ist, im Grätzl ist, wo das Wohnbauressort viel macht, Jugendpolitik haben wir schon angesprochen. Dafür braucht es eine Struktur. Die gab es jetzt schon bei der Entwicklung. Wir setzen das jetzt so auf, dass man sagen kann, ab dann gibt es quasi den Maschinenraum für die Umsetzung. Und was die Umsetzung betrifft, ist mir etwas wichtig, dass wir einfach so wie einen Stachel im Fleisch implementieren können, dass jedes Ding, das wir machen, das nach der Meinung von Menschen fragt, das Leute einlädt, mitzutun, und im Idealfall ist das so gut wie alles, was wir machen, immer fragt, ist es wirklich so, dass jeder mitmachen kann? Ist es wirklich gelungen, dass wir unser hehres Ziel, eine Stadt zu sein, die für alle da ist, umsetzen können? Und das ist ein schmerzhafter Prozess, weil es in aller Regel Luft nach oben gibt. Ganz oft ist es so, dass aus einem bestimmten Grund. Weil der Zeitplan nicht ideal war, weil es keine Kinderbetreuung gegeben hat, weil sich die Sprache so komplex anfühlt, dass man sich denkt, das hat mit mir nichts zu tun. Verschiedene Gründe, dass das dazu führt, dass dann jemand nicht mitmachen kann, weil er findet, das ist nichts für mich. Und das kann man bei anderen Politikfeldern vielleicht noch akzeptieren. Aber bei Demokratie kann man nicht akzeptieren, dass jemand findet, das ist nichts für mich. Und insofern wünsche ich mir, dass der Stachel weh tut, also dass wir ihn spüren und wirklich immer hinterfragen. Was kann man da noch mehr machen? Dass das, was wir tun, wirklich jede und jeden mitnimmt und ihm oder ihr den Eindruck gibt, du bist wichtig. Du zählst, du wirst gehört, du bist gleich wichtig wie andere und du kannst einen Beitrag leisten, der sich gut anfühlt.-Das war jetzt eine sehr herzliche Einladung, glaube ich, für alle Wienerinnen und Wiener, sich zu beteiligen und ihre Stadt mitzugestalten. Ich danke Ihnen für den Besuch im Studio.-Danke für die Einladung.-Dankeschön.
Podcasts we love
Check out these other fine podcasts recommended by us, not an algorithm.

Grätzlgeschichten
Stadt Wien
büchereicast
Stadt Wien - Büchereien
Wiener Wohnen Podcast
Wiener Wohnen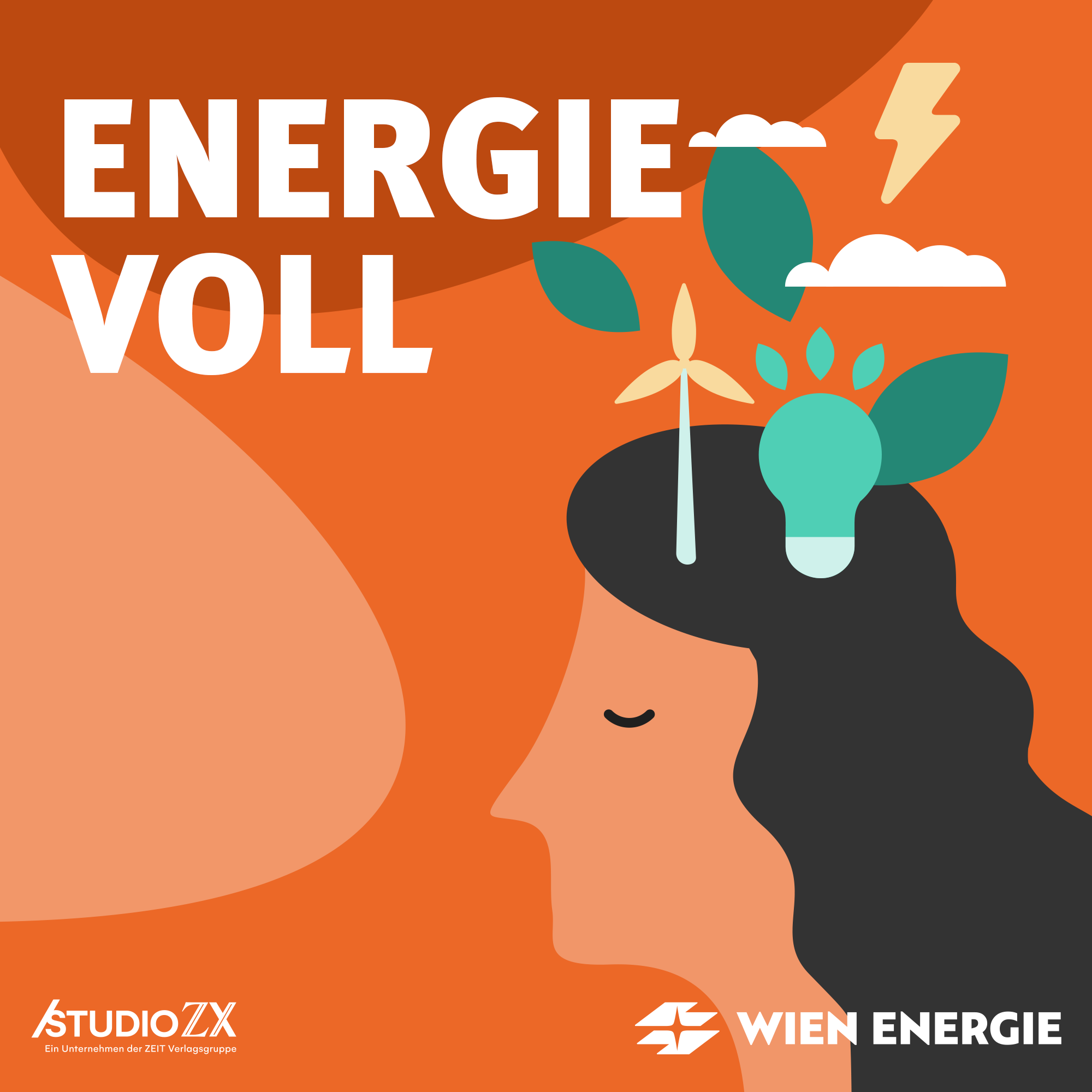
Energievoll
Wien Energie, Studio ZX